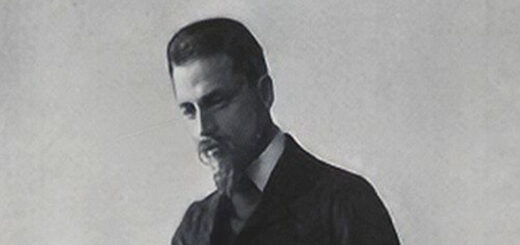Gibt es ein „richtiges“ Abschied nehmen?
In den Bundesländern werden regelmäßig neue Bestattungsregeln festgelegt

Bis vor wenigen Jahrzehnten hat die katholische Kirche Urnenbestattungen noch vehement abgelehnt. Heute ist sie auf deutschen Friedhöfen – egal ob katholisch oder evangelisch – die Regel. Quelle: 123rf.com / Foto: lightfieldstudios
Wer heutzutage an einer Beerdigung teilnimmt, dem mag es oft so erscheinen, dass man an einem unveränderlichenen Ritual beteiligt ist, an dem sich seit Jahrhunderten nur wenig geändert hat. Beschäftigt man sich aber etwa eingehender mit dem Thema, so sieht man schnell, dass auch unsere Bestattungskultur von dem stetigen Wandel betroffen ist, dem unsere Gesellschaft ja auch ganz allgemein unterliegt. Um das zu verdeutlichen, reicht schon ein Blick auf die Anzahl der kirchlichen Bestattungen. War bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts eine Beerdigung außerhalb des vorgegebenen Rahmens in den jeweiligen katholischen oder evangelischen Gemeinschaften äußerst selten und sogar oftmals mit gesellschaftlicher Ächtung verbunden, so findet heute nur noch rund jede zweite Grablegung im kirchlichen Kontext statt.
Und selbst wenn der Weg zur letzten Ruhestätte heutzutage noch im christlichen Rahmen durchgeführt wird, so ist auch dieses Zeremoniell einem Wandel unterworfen. So untersagte die katholische Kirche beispielsweise bis in die 1960er-Jahre grundsätzlich die Kremation als Bestattungsform – also das Verbrennen und die Beerdigung in einer Urne. Begründung: Eine Einäscherung stehe der Idee der Wiederauferstehung nach katholischer Glaubenslehre diametral entgegen. Seit dieses Verbot jedoch aufgehoben wurde, sind es zunehmend mehr Menschen, die auf diese Art und Weise bestattet werden – in Deutschland aktuell fast drei Viertel aller Verstorbenen. Gründe hierfür sind nicht nur rein theologischer Natur. Denn der Sinneswandel der konfessionellen Entscheidungsträger hatte auch ganz praktische Beweggründe. Beispielsweise der zunehmend problematische Platzmangel auf den kirchlich verwalteten Friedhöfen.
Verantworlich dafür, den kontinuierlichen Wandel in der Gesetztgebung zu berücksichtigen, sind die Länder. Das bedeutet, dass im Bundesgebiet eigentlich irgendwo ständig ein Bestattungsgesetz in Bearbeitung ist. Zum einen, um den geänderten Wünschen und Vorstellungen in der Bevölkerung Rechnung zu tragen oder um die Rechtsprechung an die sich fortentwickelnden technischen Entwicklungen anzupassen. Zum anderen spielen aber auch verwaltungstechnische Überlegeung hier eine gewichtige Rolle. Einfluss auf diese Gesetzgebung nehmen natürlich unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, wie zuallererst die Kirchen in Deutschland. Aber auch Interessenvertreter, Parteien und Berufsverbände versuchen hierbei ein gewichtiges Wörtchen mitzureden.
Geändert wurde das Bestattungsrecht zum Beispiel jüngst in Bayern. Seit April wurde hier unter anderem die Sargpflicht bei Beerdigungen gelockert, was dem muslimischen Ritus entgegenkommt, der verlangt, dass der Körper eines Verstorbenen meist nur in Tücher gehüllt begraben wird. Des Weiteren regelt der Gesetzestext auch das Verfahren der Leichenschau neu sowie Fristen für die Beisetzung. Auch die Bestimmungen für den Infektionsschutz wurden den aktuellen Bedingungen angepasst.
Die Entwicklung zeigt also, dass auch die Rituale, die wir bei Beerdigungen vollziehen, einer laufenden Veränderung unterworfen sind. Weitere Beispiele sind etwa auch Wald- und Seebestattungen oder auch anonymisierte Grablegungen auf herkömmlichen Friedhöfen, die von zunehmend mehr Menschen für sich gewünscht werden und vor einigen Jahren so überhaupt nicht möglich waren. Trauer und Abschiednehmen werden also Schritt für Schritt zunehmend individueller – so wie viele andere Lebensbereiche auch.