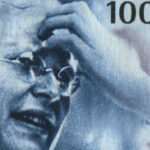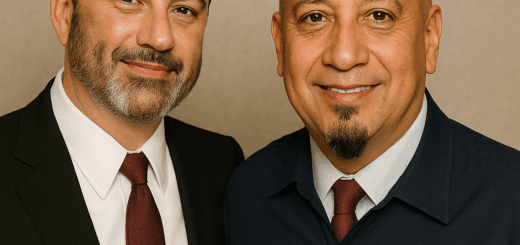Der Friedhof als Gemüsebeet
Erdbestattungen kommen aus der Mode – doch was mit ungenutzten Friedhofsflächen anfangen?

Ebenso wie der Rest der Welt ist auch die Trauer- und Begräbniskultur stetig im Wandel. Eventuell nicht so schnell voranschreitend wie andere Bereiche, aber dennoch hat sich hier besonders in den letzten Jahren viel verändert.
Feuerbestattungen haben sich hierbei zum neuen Trend entwickelt. Ihre Beliebtheit steigt immer weiter an, während die der klassischen Erdbestattung immer mehr sinkt. Bereits über 40 Prozent ziehen ersteres Ritual dem Traditionellen vor, Tendenz steigend. Das ist auf mehrere Gründe zurückzuführen.
Zum einen ist eine solche Art der Beisetzung weitaus kostengünstiger in der Durchführung. Sowie bei der anschließenden Aufbewahrung, da sie sehr viel platzsparender ist. Zum anderen entfallen auch die Kosten und der Aufwand der Grabpflege. Besonders wenn Familien umziehen oder andere Angehörige, die sich darum kümmerten, ebenfalls ableben, sind oft große Anstrengung und Umwege nötig, sich noch um das Grab zu kümmern. Das kann zur Belastung werden, wenn man die finanziellen Mittel nicht hat, für professionelle Grabpflege aufzukommen.
Eher erst kürzlicher entwickelt sich auch langsam ein weiterer neuer Trend. Und zwar seinen Körper der Wissenschaft zu spenden und so nach seinem Tod zu Bildung und Forschung beitragen zu können. Darüber kann jeder Mensch vor seinem Tod selbst entscheiden und sich bei durchführenden und für das Gebiet zuständigen Universitäten anmelden und eine Anzahlung dafür machen. Wie zum Beispiel bei der Universität Giessen mittels eines Formulars.
Beziehungsweise kann auch eine Patientenverfügung beantragt werden, mit der ein Vertrauter diese Entscheidungen fällt, sollte die Person selber aus medizinischen Gründen nicht mehr in der Lage sein.
Zwar sind diese neuen Entwicklungen noch stark regionsabhängig. In ländlichen Gegenden schreiten sie langsamer voran und die Grabbeisetzung ist nach wie vor sehr beliebt. Im Großen und Ganzen jedoch steigt der Trend hin zu Feuerbestattungen immer mehr.
Das führt jedoch zu folgendem Problem: Viele Gräber und teils ganze Bereiche von Friedhöfen bleiben leer.
Die Kosten, diese komplett zu Parks oder Ähnlichem umzubauen, sind zu hoch und können von Kirchensteuern und den übrigen Begräbniskosten nicht finanziert werden. Außerdem ist das laut Aussagen der Kirche auch nicht der Zweck, den die Kirchensteuer erfüllen soll. Aufgrund all dieser Umstände hat sich erst kürzlich ein völlig neuer Trend zur Nutzung von Friedhöfen entwickelt. Urban Gardening.
Urban Gardening auf Friedhöfen
Was konkret versteht man unter der Begriff Urban Gardening in Bezug auf Friedhöfe?
Die immer größer werdende Anzahl an leerstehenden Gräbern, genauso wie die zum Teil aufgelösten werden zu einem anderen Zweck genutzt. Als gedeihende Grünflächen für Gartenarbeit und Anbau von beispielsweise Gemüse, Obst oder bunten Blumen.
Aktuell kümmern sich um den Großteil dieser Mini-Gärten noch die Friedhofsgärtner und -mitarbeiter in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Einige werden jedoch auch bereits vermietet. Dadurch eröffnen sich besonders für in Städten lebende Menschen ganz neue Möglichkeiten. Viele von ihnen haben keinen eigenen Garten und damit keine Option, in der Ruhe der Gartenarbeit Erholung zu suchen oder ihre eigenen Lebensmittel anzupflanzen.
Dazu fehlt in den meisten großen Städten einfach der Platz und größere externe Gärten anzumieten, ist wiederum mit sehr hohen Kosten verbunden.
Solche neuen Ideen mögen vielleicht für den ein oder anderen im ersten Moment ein wenig suspekt klingen oder so, als würde man die Toten damit nicht mehr genug würdigen. Oder aber die besinnliche Umgebung dieses heiligen Ortes zerstören. Doch anhand von bisherigen Erfahrungen mit Urban Gardening an den Grabstätten lässt sich das genaue Gegenteil feststellen.
Tristen, zum Teil grauen und verlassenen Friedhöfen wird wieder neues Leben eingehaucht. Der Duft der frischen Blumen und Pflanzen verströmt vor allem Freude und Hoffnung darüber, dass der Tod nicht das Ende ist. Alle beteiligten Gärtner sind sich außerdem durchaus bewusst, an welch bedeutendem Ort sie sich befinden und arbeiten daher auch mit dem nötigen Respekt. So, dass sich Besucher und Angehörige nicht gestört fühlen, sondern viel mehr wieder willkommener an diesen einst so schönen und gleichzeitig wehmütigen Orten.
Durchführung und Hygiene
Neben der Frage, ob die Integrität dieses wichtigen Raumes dabei erhalten bleibt, ergeben sich natürlich noch weitere Fragen. Unter anderem, wie die Durchführung aussieht. Wie die Hygiene beim Anbau von Lebensmitteln an einem solchen Ort sichergestellt werden kann.
Hochbeete
Ein ganz einfacher erster Lösungsansatz für diese Fragen ist die Nutzung von Hochbeeten. Auf einem Friedhof in Berlin zum Beispiel greift man zur Anbaumethode mit Hochbeeten. Diese kann man fast ohne jeglichen Kostenaufwand aus alten Holzbrettern selber zusammenbauen. Sie werden in respektvoller Entfernung der noch aktiv genutzten Gräber aufgebaut und sind etwa einen Quadratmeter groß.
Diese spezielle Art von Beet wird nicht ausschließlich mit Erde, sondern zu einem Teil auch mit Kompost, Blättern und Rasenschnitt gefüllt und ist dadurch sparsam, umweltbewusst und orientiert an Wiederverwertung. So kann man das hierbei auch mit der übrigen Gartenarbeit der Grabstätte kombinieren und die Abfälle dieser weiterverwenden. Dadurch wird weniger Müll produziert und es kann etwas Neues daraus entstehen.
Durch die besondere Bauweise und Füllung eines solchen Beetes ist der Anbau bestimmter Pflanzen- und Gemüsesorten begünstigt. Das Verrotten der organischen Materialien im Inneren erzeugt nämlich Wärme, die in herkömmlichen Gärten in kälteren Regionen nicht entstehen würde. Diese schafft für Gewächse wie Tomaten, Zucchini, Lauch, Gurken, Paprika etc.
Durch die stetige Veränderung im Inneren hat die Erde immer wieder neue Bedingungen, auf die man sich mit unterschiedlichen Pflanzen anpassen kann. Ab dem dritten Jahr ist der Nährstoffgehalt etwas geringer und man kann von Gemüsearten, die viel Nährstoff benötigen, auf welche mit weniger Bedarf wie Salat und Spinat umsteigen. So wird das Beste aus den Bedingungen herausgeholt und es entsteht eine Vielfalt an selbst angebauten Lebensmitteln.
In aufgelassenen Gräbern
Dennoch ist auch die zweite Methode, in der Erde oberhalb der aufgelassenen Gräber anzupflanzen, keineswegs in irgendeiner Weise gefährlich oder unhygienisch.
Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass ein Grab mindestens 1,80 Meter tief sein muss. Familiengräber und Ähnliches sind noch tiefer, oftmals bis zu 3 Meter.
Für den Zweck des Blumen- und Gemüseanbaus liegt die Tiefe der Erde, in der man sie vergräbt bei circa 20 Zentimetern. Es ist also unmöglich, dass hier auch nur annähernd ein Berührungspunkt entstehen könnte.
Die jahrelange Annahme, dass infektiöse Stoffe in toten Körpern unter der Erde erhalten bleiben, hat sich als Mythos herausgestellt. Und auch die Vermutung, dass durch den Verwesungsprozess schädliche Giftstoffe in die Erde freigesetzt werden, wurde wissenschaftlich widerlegt. Damit ist auch der Anbau von Essbarem hier genauso sicher und sauber wie in jeder normalen Erde auch.
Beeren, Kartoffeln, Gurken, Salat, Zierpflanzen und vieles mehr findet hier einen geeigneten Lebens- und Wachsraum.
Vorreiter und deren Erfahrungen
Wichtige und erfolgreiche Vorreiter dieses neuen Trends waren mitunter ein Berliner Friedhof in Neukölln, genauso wie ein weiterer in der österreichischen Hauptstadt Wien.
In Berlin griff man vorrangig auf die Hochbeetmethode zurück, in Wien pflanzt man seit einer Weile oberhalb der vielen aufgelösten Gräber an. Und bisher berichten beide nur Gutes. In der deutschen Hauptstadt konnte der Friedhof so sogar wieder zu einem sichereren Ort für die Angehörigen als zuvor gemacht werden. Durch die verlassene, abgetrennte Lage hatten sich hier nämlich immer mehr Drogenabhängige gesammelt. Dem wird nun ganz automatisch entgegengewirkt, da wieder mehr Menschen und Arbeiter an diesem Ort ein- und ausgehen.
Und auch in Österreich wird dieser heilige Platz zu einem froheren Ort, ohne an Respekt zu verlieren. Man geht der Arbeit mit der nötigen Stille nach, um niemanden zu stören, der gerade trauert.
Hier wurde kürzlich auch eine weitere Idee zur Weiternutzung der leerstehenden Flächen umgesetzt. Bereits fünf Grabstellen wurden zu öffentlichen Leihbuchstellen umgewandelt. Diese laden Menschen ein, Zeit auf dem Friedhof zu verbringen und die Kunst der Literatur wieder mehr zu schätzen. Bisher hat man auch damit großen Erfolg. Weitere solchen Bücherstellen sind dort in Planung.
Fazit
Diese Vorteile einer derartigen Umfunktionierung von Gräbern ergeben sich zusammengefasst:
• Neue Grünflächen v. a. in großen Städten mit Mangel solcher
• Möglichkeit, Garten zu betreuen für Menschen, die keinen haben
• Lebensmittelanbau
• Artenerhaltung von Bienen und anderen wichtigen Insekten durch Pflanzen neuer Blumen
• Friedhöfe zu belebteren und damit sichereren Orten machen
• Freie Räume für Bildung mithilfe von z. B. Bücherstellen schaffen
• Trostspendende, respektvolle Umgebung für Trauernde erzeugen