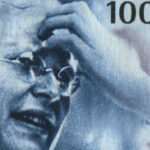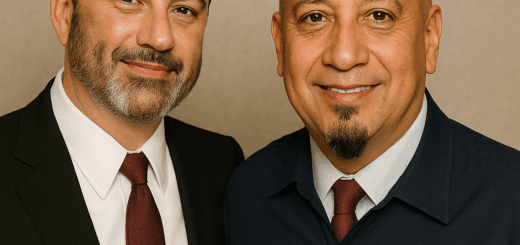Organspende, einfach erklärt
Organspenden sind wichtig – aber viele sind unentschlossen, auch wenn sie mit einem Eingriff nach ihrem Tode Leben retten könnten.

Laut der Statistik gibt es in Deutschland ungefähr 90.000 Patienten, die auf eine Dialyse angewiesen sind. Auf eine Nierentransplantation warten davon 8.000 Patienten. Zwar können Patienten, die regelmäßig zur Dialyse gehen, überleben, allerdings sind die Einschränkungen enorm. Hinzu kommt, dass auch die Dialyse an ihre Grenzen stößt. Aber nicht nur auf Nieren sind viele Patienten angewiesen. Angeborene Herzfehler oder Krankheiten wie Hepatitis C machen eine Transplantation von diesen Organen erforderlich. Gesunde Menschen können dazu beitragen, indem sie sich zu Lebzeiten einen Organspendeausweis beantragen. Was eine Organspende ist und wie am besten dabei vorzugehen ist, soll in diesem Artikel dargestellt werden.
Was ist eine Spende von Organen?
Unter einer Spende von Organen ist die Übertragung eines vollständigen Organs oder Teile davon von dem Spender auf den Empfänger zu verstehen. Die Kernidee dahinter ist, das Überleben des Patienten zu sichern bzw. die Lebensqualität des Erkrankten erheblich zu steigern.
Unterschieden werden die postmortale Spende und die Lebendspende. Die Lebendspende ist nur in wenigen Fällen möglich. Das klassische Beispiel ist die Niere. Jeder Mensch verfügt über zwei Nieren, fällt eine aus, werden sämtliche Funktionen von der anderen Niere übernommen. Aus diesem Grund ist die Spende einer Niere zu Lebzeiten möglich. Aber auch eine Teilspende der Leber kommt durchaus in Betracht.
Spende von Organen – die Voraussetzungen
Die Grundvoraussetzung, damit ein Organ vom Spender entnommen werden kann, ist der Gesundheitszustand des jeweiligen Organs. Dieses muss seine Funktionen erfüllen. Dabei spielt es in dieser Stufe noch keine Rolle, ob der Spender ein Alter von 75 Jahren aufweist oder erst 25 Jahre alt ist. Bei Organspenden ist es unerheblich, ob der Spender ein Kind oder Erwachsener ist. Bei dem Empfänger spielt dieser Unterschied ebenfalls keine Rolle.
Eine weitere Voraussetzung sind die Krankheiten des jeweiligen Organs. Es darf keine Krebserkrankung vorliegen, Tuberkulose oder gar eine Blutvergiftung. In diesen Fällen kann eine Spende nicht durchgeführt werden. Würde eine Transplantation trotzdem durchgeführt werden, wäre die Gefahr der Ansteckung sehr hoch. Liegt eine Hepatitis Erkrankung vor, ist eine Spende hingegen nicht ausgeschlossen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Empfänger ebenfalls an dieser Erkrankung leiden.
Voraussetzungen für den Empfänger
Auch beim Empfänger müssen wesentliche Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine Transplantation durchgeführt werden kann. Die Gewebestruktur zwischen Empfänger und Spender müssen übereinstimmen. Je besser diese Übereinstimmung, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das neue Organ vom Empfänger abgestoßen wird.
Die ärztliche und lebenslange Betreuung folgt auf eine Transplantation für den Empfänger. Die Immunabwehr wird für das gesamte restliche Leben herabgesetzt. Damit soll sichergestellt werden, dass das neue Organ nicht abgestoßen wird und der Körper dieses Organ nicht als Fremdkörper erkennt. Dieser Umstand sorgt allerdings dafür, dass Menschen mit fremden Organen auch gegenüber Krankheitserregern anfälliger sind. Die Organe müssen einer regelmäßigen Kontrolle unterzogen werden.
Die Anlaufstellen – an wen wendet man sich als Empfänger von Spenderorganen?
Eine erste Anlaufstelle ist in der Regel der betreuende Facharzt. Dieser schätzt die Schwere der Erkrankung ein und beurteilt im ersten Schritt, ob eine Organtransplantation notwendig ist. Daraufhin erfolgt die Überweisung in ein Transplantationszentrum. Der Patient ist nicht auf irgendein spezielles Transplantationszentrum angewiesen, sondern kann sich ein Transplantationszentrum aussuchen. Abhilfe schafft hier die Übersicht der Transplantationszentren auf der Seite der deutschen Transplantationsgesellschaft.
Im jeweiligen Transplantationszentrum wird anschließend die Notwendigkeit einer Transplantation analysiert. Ebenfalls wird hier überprüft, ob der Patient als Empfänger eines Organs geeignet ist. Hier werden alle medizinischen Daten festgehalten, die bei der Vermittlung von Organen notwendig ist. Kommt das Transplantationszentrum zu der Überzeugung, dass eine Transplantation in diesem Fall notwendig ist, werden die Daten an die Stiftung Eurotransplant übermittelt. Durch die Meldung bei Eurotransplant kommt der Patient auf die Warteliste des Organs, welches er benötigt.
Die Organtransplantation – Entscheidungshilfe für den Spender
Menschen, die überlegen, ihre Organe zu spenden, quälen sich oft mit den unterschiedlichsten Fragen. Zum einen spielt der Hirntod eine entscheidende Rolle. Kann ich sichergehen, dass der Hirntod auch eindeutig festgestellt worden ist, bevor meine Organe entnommen werden? Werde ich trotz Organspendeausweis optimal versorgt und am Leben erhalten? Wie drücke ich meinen Willen zur Organspende am besten aus? Auf diese Fragen wollen wir in diesem Abschnitt eine Antwort geben.
Eine Transplantion wird dann in Erwägung gezogen, wenn vom Arzt der Hirntod festgestellt wird. In diesem Fall funktionieren alle Organe weiter, allerdings fallen sämtliche Hirnfunktionen aus.
Eine Organspende kann nur dann durchgeführt werden, wenn der verstorbene Patient im Besitz eines Organspendeausweises ist, den er sich zu Lebzeiten ausstellen hat lassen. Liegt keine Zustimmung mittels einer eindeutigen Erklärung des Patienten vor, wendet sich das medizinische Personal an die Angehörigen. Diese eindeutige Erklärung des Patienten muss nicht zwangsläufig durch einen Organspendeausweis bewiesen werden, sondern kann auch im Rahmen einer Patientenverfügung zum Ausdruck kommen.
Werden Angehörige befragt, kommt hierbei folgende Reihenfolge zur Anwendung:
Zunächst werden Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner befragt. Anschließend erfolgt die Befragung mit volljährigen Kindern, Eltern, volljährigen Geschwistern oder gar Großeltern. Je nach Alter des Patienten kommen die unterschiedlichsten Angehörigen in Betracht.
Grundsätzlich sollten Patienten diesen Willen zu Lebzeiten festhalten. Entweder durch einen Organspendeausweis oder durch eine Patientenverfügung. Für Angehörige bedeutet diese Entscheidung eine große Belastung, die nicht zu unterschätzen ist.
Wie wird der Hirntod festgestellt?
Bevor eine Organspende in Betracht kommt, ist es eine Grundvoraussetzung, den Hirntod eindeutig festzustellen. Es muss eindeutig sein, dass alle Hirnfunktionen erloschen sind und nicht wiederhergestellt werden können. Um den Hirntod eindeutig feststellen zu können, wird ein Beobachtungszeitraum von 12 bis 72 Stunden angesetzt. Dieser Zeitraum wird in jedem Fall angewandt. Die Schwere der Hirnverletzung spielt hierbei keine Rolle. Die Organfunktionen werden durch intensivmedizinische Maßnahmen künstlich aufrechterhalten. Das ist allerdings nur für eine begrenzte Zeit möglich.
Wichtig ist außerdem, dass zwei unabhängige, erfahrene Fachärzte für die Untersuchung herangezogen werden. Damit soll das Ergebnis eindeutig sichergestellt werden.
Das Ergebnis kann zusätzlich durch ein EEG oder ein CT untermauert werden. Der Tod des Patienten ist eindeutig festgestellt, wenn alle Hirnfunktionen ausgefallen sind und diese sich auch nicht mehr wiederherstellen lassen. Rechtlich gilt der Hirntod als ein sichereres Todeszeichen.
Wo kann ein Organspendeausweis bezogen werden und was wird dort geregelt?
Der Organspendeausweis kann online bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) beantragt werden. Das Formular kann online ausgefüllt und anschließend ausgedruckt werden. Für die Beantragung des Organspendeausweises ist keine vorherige Registrierung notwendig. Der Organspendeausweis kann kostenfrei bezogen werden und steht Interessenten auch in mehreren Sprachen, als Flyer oder als Plastikkarte im Scheckkartenformat zur Verfügung.
Im Organspendeausweis kann von den Interessenten festgelegt werden, ob der Entnahme von Organen zugestimmt wird, nur bestimmte Organe entnommen werden dürfen oder ob bestimmte Personen aus dem näheren Umfeld darüber entscheiden dürfen.
Trotz Organspendeausweis ist die Versorgung des Patienten in medizinischen Einrichtungen sichergestellt. Das Leben des Patienten hat immer absolute Priorität und es werden sämtliche Maßnahmen ergriffen, um das Leben zu retten. Diese medizinische Versorgung kommt auch den Organen zugute, wenn diese später einmal gespendet werden sollen. Denn nur absolut funktionstüchtige und gesunde Organe kommen für eine Organspende überhaupt in Betracht.
Wie spricht man mit Freunden und Angehörigen?
All diese Punkte sollen für Betroffene eine Entscheidungshilfe sein. Auch gegenüber Freunden und Angehörigen sollte dieses Thema angesprochen werden. Diese können durch ihre eigenen Erfahrungen oder Einstellungen eine wertvolle Stütze sein. Es ist keine leichte Entscheidung, sich für oder gegen die Organspende zu entscheiden. Nur sehr enge Freunde und Angehörige, zu denen ein gutes Vertrauensverhältnis besteht, kommen für ein solches Gespräch in Betracht. Gerade beim Thema Organspende klaffen die Meinungen oft weit auseinander. Betroffene sollten sich vorab sicher sein, auch wirkliche Hilfe zu bekommen.
Lebensrettung – die Beratung
Im aktuellen Transplantationsgesetz § 2 Abs. 1a und 1 b dürfen Hausärzte ab dem 01. März 2022 Patienten hinsichtlich der Voraussetzungen in Bezug auf eine Organ- und Gewebespende beraten. In diesem Zuge werden die Patienten auch über die Abgabe einer Erklärung in Bezug auf die Organ- und Gewebespende im Organspenderegister informiert. Auch Patienten, die ihre Volljährigkeit noch nicht erreicht haben, können mit der Vollendung ihres 16. Lebensjahres eine Erklärung zur Organ- und Gewebespende abgeben und diese auch jederzeit abändern. Der Widerspruch gegen eine Organ- und Gewebespende ist bereits mit Vollendung des 14. Lebensjahres möglich.
Fazit:
Eine Transplantation kann Leben retten. Leider entschließen sich immer noch zu wenig Menschen zu einer Spende bzw. versäumen es ihren Willen zu Lebzeiten festzuhalten. Die Folge ist, dass Patienten, die dringend darauf angewiesen sind, die Organe nicht bekommen. Die Warteliste ist lang und viele Betroffenen müssen zu lange auf ein Organ warten. Während einige diese Zeit nicht überleben, fliegen andere von der Warteliste, weil sie mittlerweile ein zu hohes Alter erreicht haben. Vor einer eindeutigen Entscheidung sollte die Beratung in Anspruch genommen werden und sämtliche Aspekte berücksichtigt werden. Ist der Betroffene grundsätzlich dafür, sollte dieser Willen zu Lebzeiten festgehalten werden.