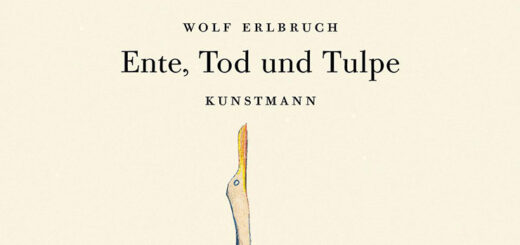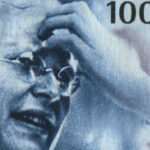Tod in der Kunst
Ob bildenden Kunst, Dichtung oder Musik – in der Kunst spielt die Themen Tod und Sterben schon seit jeher eine bedeutende Rolle.

Das Motiv des Todes ist seit vielen Jahrhunderten eines der am weitesten verbreiteten Motiven in der bildlichen Kunst, aber auch in der Literatur. Maler, Dichter und andere Künstler haben das Todesmotiv thematisch auf die unterschiedlichsten Art und Weisen v veranschaulicht und abgebildet – sei es als Tod Skulptur, Tod Gemälde oder auch als Gesichter des Todes in Form von Gemälden. Es gibt den Totentanz, die Personifizierung des Todes oder auch seine Darstellung in surrelaer Form. Wird vom Tod gesprochen, handelt es sich meist um extreme, ausdrucksstarke Bilder. Das unheimliche Dunkel, das Tor zu neuem Leben oder auch einfach das Licht – es gibt viele Formen, wie Tod und Trauer in der Kunst symbolisiert werden.
Das tatsächliche Phänomen Tod kann jedoch kein Mensch richtig greifen, da es kein theoretisches Wissen darüber gibt, was nach unserem Lesen folgt – und ob dies überhaupt der Fall ist. Wir können nur mutmaßen und aus diesem Grund gibt es tausende von Darstellungen des Todes in bildlicher oder wörtlicher Form. Der Tod begegnet uns in der bildlichen Kunst, aber auch in der Dichtung und Literatur stetig – sei es in Wort und Schrift oder in Form von Symbolen wie Totenköpfen, Kreuze oder sogar Tötungsszenen.
Es genügt ein Gang in das nächste Kunstmuseum, um festzustellen, dass viele Gemälde schon vor Jahrhunderten das Thema Tod aufgegriffen haben. Bei vielen Kunstwerken lassen sich Tötungsakte in mehr oder weniger drastischer Darstellung finden – hier kennt die Kunst keine Grenzen. Von bildlichen Szenen zweier sich bekriegender Menschen bis hin zu religiösen Szenen, in denen Jesus Christus unter gleißendem Licht auf dem Schoß der Mutter Gottes liegt, mit blutenden Hand- und Fußgelenken. Die Kunst bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten, das in der realen Welt nur allzu verwerflich wäre – das gilt für die explizite Darstellung von Gewalt genauso wie für Nacktheit und das Zurschaustellen körperlicher Ästhetik.
Darstellung der Vergänglichkeit in der Kunst
Bereits in der frühen Steinzeit, das belegen Funde, gab es bereits erste Illustrationen und bildliche Symbole von Tod und Gewalt. Obgleich es sich bei diesen archäologischen Schätzen nicht um die Werke von Künstlern handelt, sondern viel mehr um eine Demonstration des täglichen Lebens oder erlebter Szenen.
In jenem Zeitalter, das für uns als das dunkle Mittelalter bekannt ist, war die Malerei vor allem ein Instrument, um die Heilsgeschichte zu verkünden. Dies geschah unter anderem in Form aufwändiger Kirchenfresken oder auch in Form von Skulpturen. Im Mittelalter genossen nur wenige Menschen das Privileg, lesen zu können – bildliche Darstellungen waren damals umso wichtiger, um die Schöpfungsgeschichte weiterzuverbreiten und den Menschen zu vermitteln, worum es in Gottes Wort ging. Szenen wie Strafen, die in der Hölle drohten oder auch bildliche Veranschaulichungen des Jüngsten Gerichts waren hatten eine furchterregende und prägende Wirkung auf die Menschen. Auch die Darstellung des Jesus Christus am Kreuze oder Bilder leidender Märtyrer gab es im Laufe der Jahrhunderte in immer wieder unterschiedlichster Form.
Die Geschichte von uns Menschen ist klar von herrschaftlicher Gewalt und Krieg geprägt worden. Nicht nur deshalb waren die bildlichen Darstellungen von Tod und Trauer so simpel und primitiv – jedem Betrachter war sofort klar, was es bedeutete, von einem Speer getroffen zu werden oder lebendig gegrillt zu werden. Solche und viele weitere bildliche Symbole gab es zuhauf und sie verfehlten ihre Wirkung nicht.
Interessant war: Je öfter Künstler die bildliche Darstellung der greifbaren Welt in ihren Werken behandelten, desto expliziter wurde auch die Symbolik von Gewalt ung ihren Folgen.
Darstellungen von Gewalt, Todund Trauer wurden und werden nach wie vor in den unterschiedlichsten Varinaten, aber auch mit verschiedenen Intentionen, abgebildet. Sei es illustrativ, literarisch oder auch pragmatisch. Sie können als Ausdruck zur Bewältigung von Trauma dienen, aber auch zu einem tieferen Bewusstsein der eigenen Endlichkeit verhelfen.
Hundert Leben und Sterben: Der Tod als Person
Der Tod wird in der abbildenden Kunst sowie auch in der Literatur seit Jahrhunderten personifiziert. Er zeigt sich dann beispielsweise als Gevatter Tod, der mit einem langen Mantel in Erscheinung tritt und eine Sense in der Hand trägt. Eine andere Variante der Darstellung ist die allegorische Form, bei welcher der Tod eine Sanduhr in den Händen hält – ein klares Symbol für die Vergänglichkeit unseres Lebens und den damit verbundenen körperlichen Verfall. Flügel werden ihm ebenfalls oft auf Bildern verliehen, um ihn als Todesengel auftreten zu lassen.
Betrachtet man die deutsche Geschichte hinsichtlich der Themen Tod und Trauer, so zeigt sich natürlich vor dem inneren Auge umgehend das Bild des Zweiten Weltkriegs mit seinen unzähligen Opfern – Schlachtfelder, zerbombte Städte und Dunkelheit prägen die typischen Bilder. Dennoch ist die deutsche Geschichte keine Ausnahme, denn auch die Geschichte anderer Völker und Staaten forderte stets ihre Opfer und ist geprägt von Tod und Gewalt. Dazu zählen unter anderem der Dreißigjährige Krieg, die Hexenverfolgung im Mittelalter sowie auch Seuchen, welche die Menschheit immer wieder heimsuchten.
Einer der Künstler, welche den Dreißigjährigen Krieg und seine Folgen bildlich für die Ewigkeit festhielten, war beispielsweise Jacques Callot. Er zeichnete Bilder wie unter anderem Der Galgenbaum (1632). Ein Bild, welches explizit die Hinrichtung von Personen darstellt, welche sich durch das Durcheinander im Krieg nicht mehr ausreichend ernähren konnten und am Ende zu Dieben werden mussten. Dieses Beispiel ist nur eines von unzähligen Bildern von Tod und Sterben – und sicherlich längst nicht das drastischste.
Tod und Trauer in Literatur und Dichtung
Prosa und Lyrik haben sich schon immer dem Thema Tod und Trauer angenommen – angefangen bei griechichen Mythen bis hin zur blutigen römischen Geschichte und zur moderner Kriminalliteratur. Der bekannte Dichter Theodor Fontane schrieb beispielsweise eine tragische Geschichte von John Graham, welcher durch seine tiefe Liebe zu Barbara Allen erkrankt. Diese Geschichte gibt es in unzähligen Versionen – mal finden sich die Liebenden kurz vor seinem Ableben, mal spürt sie die Liebe erst nach seinem Tod. Fontane schrieb das Gedicht um 1855 in romantisierter Version, jedoch mit der Tragik des Todes und dem mit ihm verbundenen Schmerz, mit dem die Zurückgelassenen kämpfen müssen.
Fazit: Tod in der Kunst hat seinen festen Platz
Tod und Trauer sind Themen, die uns Menschen in Furcht versetzen, gleichzeitig aber auch faszinieren. Kein anderes Thema beschäftigt Wissenschaftler, Künstler, Dichter und alle anderen Menschen so sehr wie dieses. Denn keiner kann wissen, was nach unserem Ableben folgt. Ein neues Leben? Dunkelheit und Leere? Es ist und bleibt das größte Geheimnis der Menschheit.
Der Tod ist für uns Menschen unausweichlich, aber auch notwendig – jedenfalls in jener Welt, in der wir leben. Das gilt für das Ableben kleinster Pflanzen und Tiere, Menschen und auch der Erde. Der Tod ist fester Bestandteil von Zeit und Raum und verantwortlich für die Vergänglichkeit. Sofern es darüber hinaus eine Welt gibt, die Sinn macht oder sogar einen Gott, dann nur jenseits von Raum und Zeit. Begreifen können wir den Sinn des Todes jedoch erst dann, wenn wir einmal selbst damit konfrontiert werden.
Quellen
https://musermeku.org/trauer-hamburger-kunsthalle/
https://www.dw.com/de/wenn-die-künstler-trauer-tragen/a-52276137
https://www.spiegel.de/kultur/kunst-ueber-trauer-stell-dich-dem-tod-baby-a-391da928-88fb-43b3-9958-66cdbf2ea24a