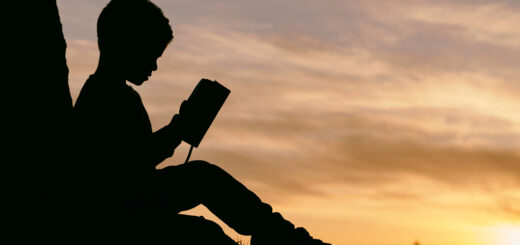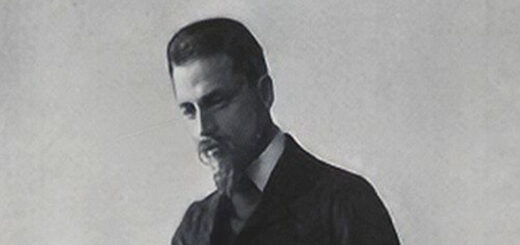Der Wald der Erinnerung – nicht nur ein Ort des Nichtvergessens
Bei Potsdam erinnert die Bundeswehr mit einer Gedenkstätte an ihre im Einsatz verstorbenen Soldaten.

Wer sich in Deutschland verpflichtet hat, sein Land, seine Heimat und alles das, was sie ausmacht, zu schützen, ist überzeugt, das Richtige zu tun oder fühlt sich dazu berufen. Das war nicht immer so.
Bis zum 30. Juni 2011 waren junge Männer mit der Erreichung ihrer Volljährigkeit gesetzlich verpflichtet, als Soldat seinen Grundwehrdienst zu leisten. Getreu seines Gewissens konnte er wählen, ob er das mit oder ohne Waffe in der Hand tut oder im Bereich des zivilen Dienstes seiner Pflicht nachkommt.
Seit ihrer Gründung, wies die Bundeswehr, je nach Bedrohungslage, eine Stärke bis zu 500 000 Mann auf. Nach der Zeit des kalten Krieges konnte sie auf die Zahl unter 200 000 abgesenkt werden.
Die Pflicht zur Ableistung seines Grundwehrdienstes in Deutschland wurde zum 1. Juli 2011 ausgesetzt. Dennoch werden mehr als 100 000 Freiwillige als Soldaten und Soldatinnen auf Zeit gezählt – mit dem ersten Tag der Freiwilligkeit entschieden sich 3.375 Männer und 44 Frauen dafür.
Einsichten, Überzeugungen, Pflichten
Männer und Frauen, die sich berufen fühlen, sich in das Heer der Soldaten und Soldatinnen einzureihen, stehen alle Wege der militärischen Ausbildung offen. Ihre Motivation ist höchstpersönlicher Art. Mit Ihrer Entscheidung werden sie Teil des Heeres.
Unser aller Respekt sollte ihnen gelten, auch wenn nicht jeder der Überzeugung ist, militärisches Handeln wäre der richtige Weg in der Zukunft. Akzeptanz wäre zu viel verlangt, Respekt ist aber das Mindeste.
Das Lied von der kleinen weißen Friedenstaube vermag, die Sehnsucht nach einem friedvollen Leben ins Gehör zu bringen. Sie vermag es aber nicht, den Frieden zu sichern.
Die bittere Erkenntnis, dass heute noch immer, wie in allen Zeiten der Menschheit davor, ein Leben im Dienst als Soldat sein Ende hat, ohne dass es zu Ende war, zeigt das Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin. Unter der Inschrift „Den Toten unserer Bundeswehr für Frieden, Recht und Freiheit“ wird dort der über 3300 seit der Bundeswehrgründung im Jahr 1955 getöteten Soldaten und Bundeswehrbediensteten gedacht.
Spät, im September 2009 eingeweiht, haben endlich die Toten der Bundeswehr einen zentralen Ort erhalten, an dem das Gedenken an die Toten in würdiger Form möglich ist.
Für wenige Sekunden erscheint auf einer kleinen Projektionsfläche hell ihr Name, bis er wieder verlöscht. Keine Helden in Stein gemeißelt – verlorene Leben im Dienst des Volkes. Kein Trost für die Hinterbliebenen – aber unvergessen für alle, die der Toten gedenken und sich vor ihnen verneigen.
Deutschlands wechselvolle Geschichte lässt sich an vielen Orten entdecken, die der Ehrung der Toten gewidmet sind. Das Ehrenmal der Bundeswehr auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums reiht sich ein in die Gedenkstätten und Denkmäler von Berlin.
Auf Initiative einer Mutter, die ihre Tochter als Offiziersanwärterin der Marine im Alter von 19 Jahren für immer verlor, entwickelte sich die Idee einer weiteren, würdevollen und wertschätzenden Gedenkstätte für alle, die ihr Leben in der Pflichterfüllung im Dienst der Armee gaben.
Der Wald der Erinnerung
An dem Ort, wo alles beginnt, die Henning-von-Tresckow-Kaserne nahe Potsdam, hat der Wald der Erinnerung seinen Platz nahe der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland gefunden. Die in der Bundeswehr entstandene Gedenk- und Erinnerungskultur findet hier einen Raum für das öffentliche ehrende Gedenken in Verbindung mit dem Anliegen, den Hinterbliebenen die persönliche Erinnerung und die private Trauer zu ermöglichen.
Für diejenigen, die im Dienst als Soldaten oder Soldatinnen ihr Leben gaben, schließt sich hier der Kreis. Die Henning-von-Tresckow-Kaserne ist der Sitz des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr. Hier werden sämtliche Einsätze geplant und geführt. Das zentrale Kommando trägt die Verantwortung im Rahmen der Auslandseinsätze sowohl für das Personal als auch für das Material.
Seit 2014 ist die Kaserne auch der Ort des Gedenkens – auf ihrem Gelände entstand in Ergänzung des Ehrenmals in Berlin der Erinnerungswald, gewidmet der in ihrer Pflichterfüllung gestorbenen Soldaten und Soldatinnen.
Das 4.500 Quadratmeter große Areal bietet mit natürlichem Bestand von Laub- und Nadelbäumen einen würdigen Platz für die Ehrenhaine in den Orten der Einsatzgebiete in Afghanistan, Bosnien-Herzegowina und Kosovo. Aus der Anonymität eines fremden Landes überführt, wurden die Ehrenhaine an diesem Platz wiedererrichtet und fanden hier in einer würdevollen Umgebung ihren endgültigen Ort. Damit bekam der Tod in einem fernen Land einen Namen in der Heimat.
Ein Ausstellungsgebäude und ein Gedenkort der Stille sind mit einem Weg der Erinnerung miteinander verbunden. Diesen säumen Stelen, die aus erdfarbenen Ziegeln errichtet sind. Auf ihnen ist jeder Verstorbene namentlich mit seinem Todesjahr und dem Einsatzgebiet in bronzenen Buchstaben verewigt.
Dahinter, links und rechts des Weges, zwischen den Bäumen, befinden sich die Ehrenhaine. An den Bäumen ist Platz für private Gedenktafeln und individuelle Elemente.
Der Staat und die Angehörigen – die Hinterbliebenen
Der Wald der Erinnerung ist öffentlicher Ausdruck des Bewusstseins darüber, dass die Toten ihr höchstes Gut, ihr Leben, für die Gesellschaft über die Grenzen ihrer Heimat hinaus gegeben haben.
Seit 1992 sind Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr im Auslandseinsatz – 116 von ihnen gaben ihr Leben und kehrten nicht zurück.
Im Wald der Erinnerung verbindet sich das öffentliche Gedenken mit dem persönlichen Schmerz des Verlusts und der Trauer – eine Möglichkeit des würdevollen Abschieds und einer versöhnlichen Umarmung der Hinterbliebenen zugleich.
Der Erinnerungswald – ein Ort der Begegnung
Nirgendwo anders treffen Schicksale so aufeinander wie hier. Sie gleichen sich in einem Punkt: Angehörige trauern um ihren Sohn, ihren Mann, ihren Vater, ihren Bruder, ihre Tochter oder ihre Schwester, die im Dienst und ihrer Pflichterfüllung während eines der Auslandseinsätze aus dem Leben gerissen wurden.
Die Hinterbliebenen finden sich zusammen im stillen Gedenken. Sie kommen sich nahe, weil sie um ihre Gemeinsamkeit wissen. Fremde finden sich im Schmerz und teilen ihn vielleicht. Das gemeinsame und das individuelle Anliegen verbindet. Neben der persönlichen Zwiesprache mit dem Verstorbenen bietet sich hier der Raum für den Austausch mit anderen Betroffenen. Sie können sich gedanklich auf eine gemeinsame Reise in ein fernes Land begeben, das ihnen durch den Tod ihres geliebten Menschen nicht mehr fremd ist.
Auf den Stelen verbinden sich die Orte und die Namen der Soldaten, die dort während ihres Auslandseinsatzes ihr Leben verloren.
Damit hebt sich diese Stätte ab von den Denkmälern unbekannter Soldaten – das Sterben im Dienst für den Frieden bekommt Namen und Orte.
Der Wald der Erinnerung ist ein zentraler Ort des Gedenkens und die Stätte der Begegnung auch derer, die sich in Dankbarkeit mit den Getöteten verbunden fühlen. Das sind die nächsten Angehörigen, die Kameraden, die Freunde, aber auch Veteranen, Gäste und Bürger des Landes. Damit erhält neben der persönlichen Trauer auch die öffentliche Wertschätzung den Raum, denen die Toten gebieten.
Der Wald der Erinnerung ist mehr als eine Gedenkstätte: Er ist der öffentliche Ort der Mahnung, der würdevollen Ehrung der Toten und zugleich der Platz für die Achtung des Lebens.
Die Verbindung des Lebens mit dem Tod wird nirgendwo deutlicher als an einer Stätte des Gedenkens inmitten von Bäumen im Wechsel der Jahreszeiten. Nichts macht mehr Hoffnung als ein Baum, dessen Zweige im Frühjahr Knospen treiben und der im Sommer mit seiner grünen Krone Schatten spendet. Sein buntes Laub im Herbst erinnert an die Vergänglichkeit des Lebens, nicht ohne den Ausblick auf ein neues Leben im folgenden Frühling.