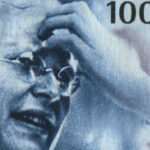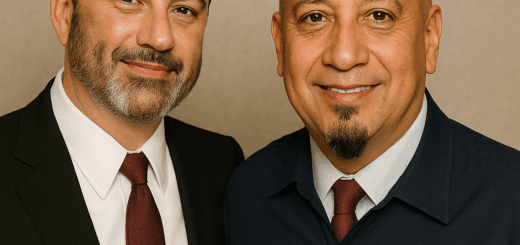Patientenverfügung – für eine verantwortungsvolle Vorsorge
Wer seine Hinterbliebenen entlasten möchte, der kann vorsorgen.
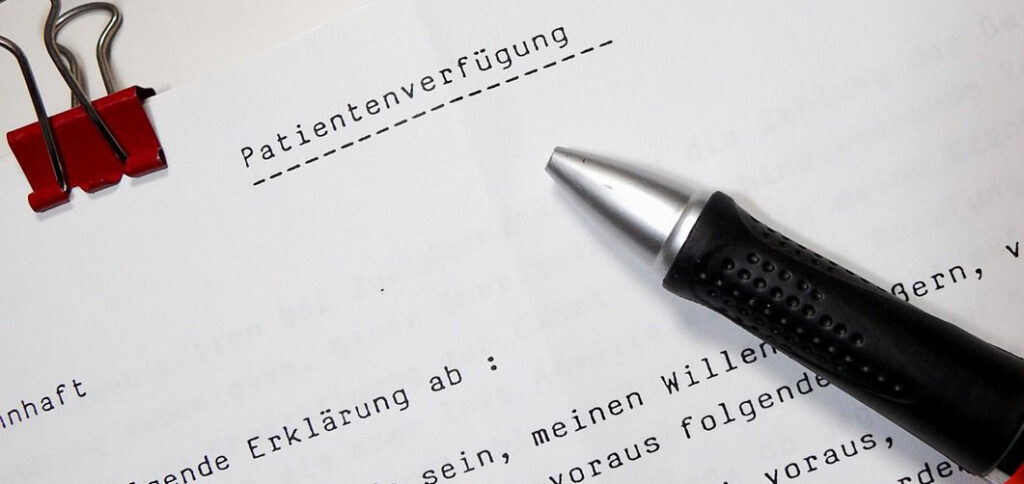
Das Leben ist voller Überraschungen – die einen nennen es Lauf der Dinge, die anderen Schicksal oder Bestimmung. In den seltensten Fällen kommt es im Leben so, wie erhofft. „Unverhofft kommt oft“ ist schnell scherzhaft dahingesagt, trifft aber auch den Kern, wenn es um Geschehnisse geht, die fernab der persönlichen Lebensplanung liegen. Deshalb sollte allein die Möglichkeit, es könnte anders kommen als erwartet, im Kalkül mit bedacht sein. Besonders dann, wenn es um Ereignisse geht, die maßgeblich das Leben in seiner Qualität negativ beeinflussen können.
Die Motivation
Freunde und geliebte Menschen halten oft fest – wie kann einer da mit ruhigem Gewissen Entscheidungen von ihnen verlangen, die vielleicht mit dem schwierigen Loslassen einhergehen, wenn er sie nicht zu Lebzeiten ausdrücklich dafür ermächtigt hat?
Die Patientenverfügung ist die Bezeichnung für einen Teil der Wegstrecke zum guten Tod. Ist er immanenter Bestandteil im Leben, gehört die Bestimmung des Umgangs miteinander im äußersten Notfall mit dazu.
Liegt keine Verfügung mit der Klarheit über den Willen in einer medizinischen Extremsituation vor, muss bei besonders schwer zu treffenden Entscheidungen durch die nächsten Angehörigen die Genehmigung für medizinisches Tun oder Lassen bei dem Betreuungsgericht eingeholt werden. Das wäre eine Fremdbestimmung äußerster Art, die einer selbstbestimmten Lebensweise entgegenstehen und im Fall des Todes Hinterbliebene nicht entlastet.
Die Vorsorge verhindert nicht das Geschehen, sie kann aber seine Folgen so weit im Zaum halten, wie es die Verantwortung für sich selbst und den Nächsten gegenüber verlangt.
Sie bestimmt mit kluger Voraussicht, was mit einem Menschen geschehen soll, wenn er persönlich nicht in der Lage ist sich zu äußern, und entlastet die Menschen im Extremfall, die im Umgang damit meist überfordert sind und eine emotionale Qual aushalten müssen.
Freunde und in Liebe verbundene Personen sollten es wert sein, schmerzliche Entscheidungen nicht für nahestehende Menschen treffen zu müssen. Jeder, der ein selbstbestimmtes Leben führt, sollte es sich selbst wert sein, in entscheidenden Momenten nicht anderen zu überlassen, wie sich der Lauf seines Lebens fortsetzt oder es endet.
Der wesentliche Bereich der Entscheidungen
Es ist nicht nur die Entscheidung über den Tod oder das Leben – dazwischen gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die nicht in der Planung des Lebens vorgesehen sind, aber nicht von Vornherein ausgeschlossen werden können. Dieser Tatsache in die Augen geblickt, ist die Patientenverfügung für jeden ein Instrument, rechtswirksam das auszuschließen, was persönlich für sein Leben als unmöglich definiert ist.
Manchmal kann im akuten Fall bei Unfällen und in einer Notfallsituation bei Krankheit nicht ausgeschlossen werden, dass trotz medizinischer Maßnahmen nur eine minimale Lebensqualität des Betroffenen erreicht wird oder dass der Mensch ausschließlich unter Einsatz von Apparaturen technischer Art am Leben bleibt.
Die Patientenverfügung sichert den persönlichen Willen, der dann gehört wird, wenn man ihn auf keine andere Weise verständlich machen kann. Sie ist ein eigenes, rechtsverbindliches Instrument der Entscheidung für die Art des Lebens oder sein Ende.
Die Patientenverfügung zieht Grenzen
In bestimmten Situationen können Grenzen der Behandlung gesetzt werden. Das können beispielsweise sein:
- die Verabreichung künstlicher Ernährung
- die Verabreichung bestimmter, das Leiden lindernde Medikamente
- der Einsatz maschineller Beatmung
- die Reanimierung
- der Empfang von Organen
- die medizinischen Maßnahmen über eine bestimmte Dauer hinaus, mit dem Ziel der Erreichung einer persönlich definierten Grenze der Lebensqualität
Die Patientenverfügung sichert den Respekt vor der Selbstbestimmtheit eines Menschen für den Fall, dass er nicht mehr in der Lage ist, über dessen Einhaltung wachen zu können.
Er liefert sich damit nicht Situationen aus, die er für sein Leben absolut nicht akzeptieren kann:
Medizinische Maßnahmen, die über einen unendlich langen Zeitraum durchgeführt, mit höchster Wahrscheinlichkeit als Ergebnis die persönliche Grenze der minimalsten Lebensqualität unterschreiten.
Der Geltungsbereich der Verfügung stellt sicher, in welcher Situation darauf zurückgegriffen werden muss. Meist sind das:
- die unmittelbare Todesnähe
- die Schädigung des Gehirns, die mit dem unwiederbringlichen Verlust der Einsichtsfähigkeit verbunden ist
- die Verzögerung des unmittelbaren Sterbeprozesses
Das Vertrauen – sich selbst die Last nehmen und Hinterbliebene entlasten
Wenn ein Mensch durch den Einsatz lebenserhaltender Instrumente am Leben erhalten bleiben kann und die Prognose einer Besserung erwarten lässt, ist sein Leben abhängig von diesen, ohne dass er selbst Einfluss nehmen kann. Die Macht der Entscheidung dafür oder dagegen liegt in der Kompetenz der Fachärzte. Die Zustimmung des Patienten zu derartigen Maßnahmen wird vorausgesetzt, es sei denn, er hat seine Entscheidung mit klarem Verstand formuliert und schriftlich niedergelegt.
Wer zu Lebzeiten gemeinsam den nahestehenden Personen oder den nächsten Angehörigen sachlich dazu die eigene Position erläutert und seinen Willen schriftlich dokumentiert hat, erlangt Sicherheit im Vertrauen und kann sich darauf verlassen, dass alles in seinem Sinne geschieht. Mit dem beruhigenden Gefühl, die Hinterbliebenen entlastet zu haben, lässt sich unaufgeregt an den Fall aller Fälle denken.
Zusätzlich können im Rahmen der Patientenverfügung Vertrauenspersonen als Entscheidungshilfen für die Ärzte bestimmt werden, die in kritischen Situationen gemeinsam beraten sollen und dürfen, wie verfahren werden soll.
Das gibt den Angehörigen die Sicherheit, schlussendlich eine richtige Entscheidung im Sinne und dem Wollen des Menschen getroffen zu haben, von dem sie sich zugleich verabschieden müssen.
Die Verfügung – formlos oder per Formular
Die gesetzliche Grundlage ist im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Eine Vielzahl an Broschüren geben gute Ratschläge und Tipps. Als Anregung zur Gestaltung sind sie sehr hilfreich. Nützliche Beispiele geben eine Orientierung zur textlichen Gestaltung und Formulierungen des Patientenwillens.
Das Gesetz verlangt kein Formular. Die einfache Schriftform ist ausreichend: Das heißt der Patientenwille muss schriftlich verfasst sein und das Datum sowie die eigenhändige Unterschrift aufweisen.
Vorlagen und Formulare sind in Papierform oder auch im Online-Service staatlicher Institutionen erhältlich. Die Textbausteine können entsprechend der individuellen Vorstellungen zueinander gefügt werden. Computergestützte Ausfertigungen erlangen, anders als beim Testament, Rechtsgültigkeit.
Da oft keine Klarheit über die Tragweite der vorformulierten und als eigene, übernommene Entscheidung besteht, ist es empfehlenswert, eine professionelle Auskunft einzuholen. Ein Arzt des Vertrauens kann zu den persönlichen Plänen und den beabsichtigten Regelungen medizinisch beraten und mögliche Konsequenzen erläutern.
Eine Rechtsberatung ist nicht unbedingt erforderlich. Sollte Anlass bestehen, kann ein Zeuge den Vollbesitz der geistigen Kräfte des Vorgesorgten mit seiner Unterschrift bestätigen. Eine notarielle Beurkundung kann erfolgen, ist aber nicht zwingend erforderlich.
Der Patientenwille sollte bei Bezugspersonen, beim Hausarzt und bei den persönlichen Dokumenten zu Hause abgelegt werden. Sie kann zu jeder Zeit widerrufen werden. Gut ist, sie von Zeit zu Zeit zu überdenken und mit dem Datum zu aktualisiert.