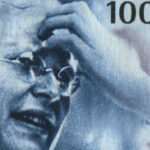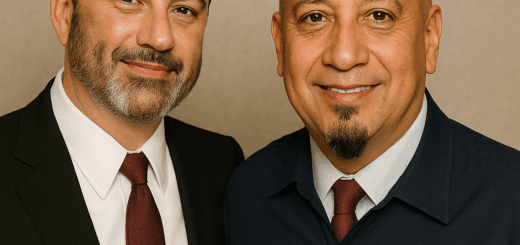Worum geht es eigentlich beim Totensonntag?
Am letzten Sonntag vor dem 1. Advent wir den Verstorbenen des letzten Jahres gedacht.

Im Dezember prägt die (Vor-)Weihnachtszeit und ihr festlicher Charakter das Leben der meisten Menschen. Im November steht – vor allem für Gläubige, aber nicht nur – ein anderes Thema im Blickpunkt: das Gedenken an die Verstorbenen. Allerheiligen, Allerseelen, der Volkstrauertag sind Anlässe, um sich mit den Toten auseinanderzusetzen – ebenso wie der den Monat in diesem Sinne abschließende Totensonntag. Was genau aber steckt hinter ihm, wie wird er begangen und wie unterscheidet er sich von den anderen Tagen der Trauer?
Das Datum:
Der Totensonntag ist stets der letzte Sonntag vor dem ersten Adventstag und damit der letzte Sonntag des offiziellen Kirchenjahrs. Die möglichen Termine fallen zwischen den 20. und 26. November.
Herkunft und Geschichte des Gedenktags:
Der Totensonntag ist in der evangelischen Tradition der Gedenktag für die Verstorbenen. In der katholischen Kirche ist dafür der Allerseelentag am 2. November vorgesehen. Das Thema spielt aber speziell in der Moderne auch schon an Allerheiligen am 1. November eine Rolle, auch wenn es an dem Tag eigentlich – wie der Name sagt – um das Andenken an die Heiligen geht. Die Geschichte des protestantischen Pendants geht zurück bis in die Reformationszeit, offiziell eingeführt wurde der Tag aber erst im Jahr 1816. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. erklärte ihn zum „allgemeinen Kirchenfest zur Erinnerung an die Verstorbenen“.
Neben den prinzipiellen Erwägungen, ein Gegengewicht zur katholischen Allerseelen-Tradition zu schaffen, spielte der historische Hintergrund eine tragende Rolle. Friedrich Wilhelms Reich stand unter dem Eindruck der Gräuel der Befreiungskriege von 1813 bis 1815: In den Kampfhandlungen, mit denen die französische Vorherrschaft unter Napoleon Bonaparte in Mitteleuropa beendet wurde, verloren hunderttausende Menschen ihr Leben. Allein bei der berühmten Völkerschlacht bei Leipzig 1813 gab es auf preußischer Seite 16.600 Tote und Verwundete. Das Andenken an die Kriegsopfer hochzuhalten, war ein wesentlicher Faktor hinter Friedrich Wilhelms Entschluss. Den Volkstrauertag, bei dem die durch Krieg und Gewalt ums Leben Gekommenen heute im Mittelpunkt stehen, gab es damals noch nicht. Er wurde erst im 20. Jahrhundert nach dem 1. Weltkrieg aus der Taufe gehoben.
Auch Friedrich Wilhelms persönliche Trauer um seine Gemahlin Luise gilt als Ereignis, das die Entstehungsgeschichte der Totensonntags-Verordnung beeinflusst hat. Königin Luise war 19. Juli 1810 infolge einer Herzerkrankung verstorben. Begünstigt wurde die Entstehung der neuen Tradition auch vom generellen Zeitgeist: Es war die Hochzeit der Romantik, in der die Auseinandersetzung mit dem Tod und die Sehnsucht nach Ewigkeit wichtige Pfeiler des kulturellen Selbstverständnisses waren.
Die Bedeutung des Fests:
Im Kern ist der Totensonntag ein Tag des Andenkens und des Trostes für Menschen, die im abgelaufenen Kirchenjahr einen Angehörigen verloren haben – und ein Anlass, sich die Endlichkeit und Vergänglichkeit des Lebens und die oft verdrängte Allgegenwärtigkeit des Todes ins Bewusstsein zu rufen. Aus kirchlich-theologischer Sicht betrachtet, ist die Bedeutungsgeschichte des Tages aber etwas komplexer.
Die Evangelische Kirche nennt den Tag oft lieber Ewigkeitssonntag und rückt damit einen anderen Aspekt als den Tod an sich in den Fokus: das ewige Leben, in das die Verstorbenen nach christlichem Glauben eingehen und die Aussicht auf den Jüngsten Tag und die Wiederkehr Christi. Das Motiv der Ewigkeit steht dabei auch für die alle Zeiten überdauernde Allmacht Gottes, im Kontrast zu der Endlichkeit von Mensch und Schöpfung. Alternative Namen für den Ewigkeitssonntag lauten auch:
- Sonntag vom Jüngsten Tage
- Letzten Sonntag des Kirchenjahres
- Gedenktag der Entschlafenen
Der Liturgische Kalender, auf den die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) auf ihrer Homepage verweist, fasst die Essenz des Tages so zusammen: „Am Totensonntag oder Gedenktag der Entschlafenen stehen Abschied und Erinnerung an die Verstorbenen im Mittelpunkt. In den Kirchen werden Namen verlesen und Kerzen entzündet. Schmerz und Hoffnung liegen dicht beieinander: Auch die Toten fallen nicht tiefer als in Gottes Hand.“
Wie wird der Totensonntag begangen?
Ein zentrales Ritual ist in vielen Kirchen die Verlesung der Namen derer, die im Jahr zuvor gestorben sind, üblich ist auch vielerorts Kerzen für sie anzuzünden. In liturgischen Lesungen stehen die Themen Tod und Ewigkeit im Fokus, dabei findet auch das tröstende Element der Hoffnung auf das ewige Leben viel Raum. Menschen, die den Totensonntag im Blick haben, nehmen ihn zum Anlass, die Gräber ihrer verstorbenen Lieben zu besuchen, zu pflegen und zu schmücken.
Abseits des rituellen Rahmens bietet der Totensonntag auch Raum für persönliches Nachdenken und Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod oder dem Tod naher Angehöriger – und Themen wie Testament, Beerdigung, Patientenverfügung.
Der gesetzliche Rahmen des Gedenkens:
Der Ewigkeitssonntag ist kein gesetzlicher Feiertag, aber es gibt auf Länderebene spezielle Regelungen, die den „stillen Feiertag“ schützen sollen, ähnlich wie auch am Karfreitag und an Allerheiligen. Je nach Bundesland sind am ganzen oder großen Teilen des Tages laute und auf unpassende Weise fröhliche Veranstaltungen verboten, die dem „ernsten Charakter“ des Gedenktags zuwiderlaufen. Es geht dabei zum Beispiel um „unernste“ Musikaufführungen in Gaststätten und Diskotheken, Sportveranstaltungen oder aber auch um Weihnachtsmärkte: Diese am Sonntag vor dem Advent zu eröffnen, ist tabu. Die meisten Weihnachtsmärkte beginnen in der ersten Adventswoche. Kirchenvertreter halten ihre Gläubigen auch dazu an, bis dahin auf winterliche Beleuchtung und Ausschmückung ihrer Häuser zu verzichten.
Der Ewigkeitssonntag aus katholischer Perspektive
Die römisch-katholische Kirche gedenkt offiziell an Allerseelen am 2. November ihrer Verstorbenen – eine Tradition, die bis ins Jahr 998 zurückreicht. Aber auch der letzte Sonntag vor dem Advent ist dort mit Bedeutung aufgeladen: Er wird als Christkönigssonntag begangen. Dieses Hochfest ist eine recht junge Tradition, die im Jahr 1925 entstand und im Zuge der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils im Jahr 1970 auf den letzten Sonntag des Kirchenjahrs verlegt wurde.
Papst Pius XI. führte das Christkönigsfest ein, um die Gläubigen an die Königswürde und den Herrschaftsanspruch Jesu zu erinnern – auch als Signal gegen den damals schon spürbaren Bedeutungsverlust der Kirche, die weltpolitischen Wirren nach dem 1. Weltkrieg und das Erstarken der faschistischen und kommunistischen Bewegungen. Den Christkönigssonntag gibt es auch in der anglikanischen Kirche und in lutherischen Kirchen im angelsächsischen Raum. Die Betonung der Königsherrschaft Christi und ihrem Ewigkeitsanspruch ist eine Verbindung zwischen der katholischen und der protestantischen Tradition und Deutung des Tages.
Quellen:
https://www.ekd.de/Ewigkeitssonntag-10838.htm
https://www.katholisch.de/artikel/168-jesus-als-herrscher