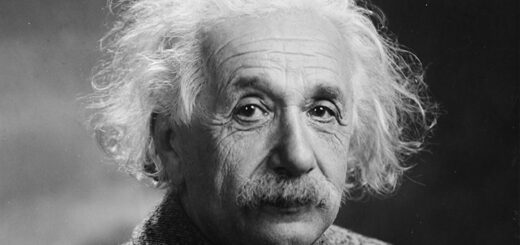Leben im Schatten des Todes
Ein Mensch weiß, dass er bald sterben wird – wie geht er damit um?

Eine vielleicht abgedroschene Phrase den Tod betreffend lautet „Der Tod gehört zum Leben dazu“. Dieser Satz klingt banal, beschreibt aber gleichzeitig eine brutale Wirklichkeit, die sich jeder Mensch stellen muss. Nicht umsonst lautet eines der vielen Synonyme für den Tod „Der große Gleichmacher“. Es ist völlig gleichgültig, ob man schwarz oder weiß, Deutscher, Japaner, oder Sudanese ist, Christ, Jude, oder Muslim, bettelarm oder milliardenschwer: Sterben müssen alle einmal, es ist, wenn man es genau nimmt, die einzige absolute Gewissheit, die das Leben bereithält.
Oft verdrängen Menschen ihre eigene Sterblichkeit. Das Thema gerät dann vermehrt in das Bewusstsein, wenn jemand im eigenen Umfeld stirbt oder eine schwere, lebensbedrohliche Krankheit wie Krebs diagnostiziert wird.
In die Wahrnehmung vieler Menschen gerät der Tod auch, wenn eine bekannte Person des öffentlichen Lebens bekannt macht, an einer schweren Erkrankung zu leiden und den Tod vor Augen hat.
Tim Lobinger – „Heilung wird es bei mir nicht mehr geben“
Der ehemalige Stabhochsprung-Weltmeister Tim Lobinger schockierte jüngst mit Angaben zu seiner seit 2017 bekannten Blutkrebs-Erkrankung. Er ließ verlauten, dass es bei ihm keine Heilung mehr geben werde, da der Krebs zu aggressiv sei. Bereits im Februar hätten ihm seine Ärzte gesagt, dass ein näher rücke und er notwendige Angelegenheiten seinen Nachlass betreffend regeln solle.
Tim Lobinger ist 50 Jahre alt, hat drei Kinder, das Jüngste wurde 2016 geboren. Er war von Beginn an sehr offen mit seiner schweren Erkrankung umgegangen, hatte mehrfach, seinem Sportsgeist entsprechend, angekündigt, gegen die Krankheit kämpfen und jede Chance zur Heilung wahrnehmen zu wollen. Für einen Weltmeister kommt es nicht infrage, aufzugeben.
Und trotzdem, so scheint es, wird Tim Lobinger diesen Kampf nicht gewinnen zu können. Welche Rückschlüsse kann man ziehen aus derart tragischen Schicksalen, woran kann man sich festhalten, wenn man den sicheren Tod vor Augen hat, woraus kann man Kraft schöpfen?
Der Tod als einer der zentralen Bestandteile der menschlichen Kultur
Wahrscheinlich hat kaum eine andere Frage die Menschheit in ihrer Geschichte so sehr bewegt, wie die Frage, was nach dem Tod kommt. Die (vermeintliche) Antwort ist wesentlicher Bestandteil der Weltreligionen. Es gibt Versprechungen über das Leben in einem paradiesischen Jenseits ohne Leid und Qualen, Versprechungen über die Erfüllung aller Wünsche, die dem Menschen zu Lebzeiten verwehrt gewesen sind.
Die Vorstellung, was den Menschen nach dem Tod erwartet und ihn überhaupt etwas erwartet, ist stark vom jeweiligen Glauben abhängig, selbst dann, wenn man sich eigentlich als Atheist bezeichnet.
Tatsache bleibt, dass kein Mensch wissen kann, was ihn nach dem Tod erwartet und vermutlich wird dies auch ein Geheimnis bleiben, das niemals entschlüsselt werden kann.
Unter dieser nicht zu beseitigenden Ungewissheit stellt sich deshalb die Frage, wie Menschen im Schatten des Todes leben können, wie Sterbende und ihre Angehörigen einen Umgang mit ihrer Angst und mit ihrer Trauer finden können.
Tod und Trauer in der europäischen Kultur
Das unangenehme Thema um die eigene Sterblichkeit ist in der modernen Welt immer mehr aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden, das Sterben ist zusehends zur „Privatsache“ erklärt worden.
In früherer Zeit prägte das „Memento mori“-Denken die Menschen. Memento Mori – „Sei dir der Sterblichkeit bewusst“. Der schon im antiken Rom bekannte Satz gewann vor allem im europäischen Mittelalter infolge der schweren Pest-Epidemien an Bedeutung. Das Sterben war etwas Alltägliches, es war aus dem öffentlichen Raum nicht wegzudenken, sondern ein ständig präsenter Teil der Lebensrealität.
Je älter die Menschen dank des technologischen Fortschritts wurden, desto mehr wurde der Tod aus der öffentlichen Wahrnehmung herausgedrängt – obwohl jeder Mensch bis heute noch sterblich ist.
Inzwischen ist der Tod so etwas wie ein Tabuthema, niemand redet gern darüber, Gespräche, die in diese Richtung gehen, werden häufig so kurz wie nur möglich gehalten. Heute sterben 80 % der Deutschen in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder in Hospizen, was oft „Institutionalisierung des Todes“ genannt wird.
Ein neuer Umgang mit dem Unausweichlichen
Lange waren sogenannte „Phasenmodelle“ die Antwort auf die Frage, wie Sterbende und Angehörige mit dem nahenden Tod umgehen sollten:
Dem gängigsten dieser Phasenmodelle nach durchlaufe man fünf Phasen, von der Leugnung des nahenden Todes bis hin zu schließlicher Akzeptanz des Unausweichlichen.
Schwerkranken und Trauernden schrieb dieses Modell gewissermaßen vor, wie mit Trauer umzugehen sei und gleichzeitig wurde mit der letzten Stufe der „Akzeptanz“ auch ein Ende dieses Prozesses beschrieben.
Von dieser strengen Systematik entfernt man sich gerade wieder, denn man versteht wieder zunehmend, dass Trauer genau das Gefühl ist, das jemand hat, wenn ein nahestehender Mensch schwer erkrankt und schließlich verstirbt. Und je größer der Verlust ist, umso größer ist die Trauer. Und das darf sie auch sein. Denn Trauer ist ein aufrichtiges Zeichen von Liebe gegenüber den Menschen, die wir verlieren. Es bringt nichts, diese trauernden Menschen mit Plattitüden aufzumuntern oder ihnen gar vorzuwerfen „zu lange zu trauern“, wie es ebenso wenig bringt, die Trauer in die festen Strukturen von „Phasenmodellen“ zu pressen oder die Gefühle von Trauernden kleinzureden.
Wissen dass man sterben wird – Wie kann man damit umgehen?
Diese Frage stellt sich sowohl für Schwerkranke selbst, als auch für die Angehörigen, vor allem dann, wenn das nahende Lebensende über eine längere Zeit absehbar ist, weil zum Beispiel eine Diagnose gleichzeitig ein sicherer Tod ist.
Viele Todkranke äußern weniger die Sorge um sich selbst, sondern darum, wie es ihren Angehörigen ergehen wird, vor allem, wenn unmittelbar jüngere Kinder zum engsten Angehörigenkreis gehören. An dieser Stelle muss man auch darauf hinweisen, dass auch für ältere Kinder, auch wenn diese selbst schon seit langer Zeit erwachsen sind, der Tod eines Elternteils ein äußerst belastendes Ereignis sein kann. In der Gesellschaft wird oft unausgesprochen vorausgesetzt, dass nur jüngere Kinder mit ganzen Herzen um ein Elternteil trauern dürfen und erwachsene Trauernde möglichst schnell in den normalen Lebensalltag zurückkehren und mit ihrer Trauer abschließen sollten.
Hoffnung und Kraft schöpfen, mit dem Tod vor Augen – Geht das überhaupt?
Es gibt wohl kein Patentrezept, das allen Kranken und ihren Angehörigen gleichermaßen in dieser Situation helfen kann.
Hilfreich ist es sicher, die eigene Angst und Trauer als eine normale, zutiefst menschliche Reaktion zu akzeptieren. Zudem kann es helfen, die Ursache der Angst zu identifizieren? Ist es die Angst vor dem Sterben beziehungsweise dem Tod selbst oder vor dem Prozess des Sterbens? Bei Letzterem kann ärztliche Beratung, etwa über die wirksamen Möglichkeiten zur Schmerzbehandlung, sinnvoll sein.
Auch das Hinzuziehen naher Freunde kann in dieser schwierigen Zeit eine Unterstützung sein, für Sterbende wie Angehörige gleichermaßen. Reden und sich mitteilen schafft Entlastung und kann das Herz, wenigstens eine Zeitlang, ein wenig von der Last der Angst und Trauer befreien.
Die Beschäftigung mit religiösen und philosophischen Fragen kann ebenfalls Halt bieten.
Grundsätzlich wäre es vielleicht ratsam, dem Tod, vielleicht schon bevor er in das Leben tritt oder sich durch die Diagnose einer schweren Krankheit angekündigt, seinen festen Platz einzuräumen und ihn als die Unausweichlichkeit anzuerkennen, die er ist, mit all den Emotionen wie Angst und Trauer.
Quellen:
https://www.ardalpha.de/wissen/psychologie/tod-trauer-liebe-begleitung-verlust-beziehung-100.html