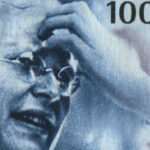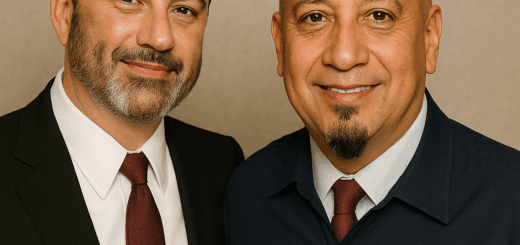Ein Jahrhundertleben gegen das Vergessen
Zum Tode von Margot Friedländer (1921–2025)

Am 9. Mai 2025 ist Margot Friedländer im Alter von 103 Jahren in Berlin gestorben. Mit ihr verliert Deutschland eine der letzten lebenden Holocaust-Überlebenden – und eine der eindrucksvollsten Stimmen der Erinnerungskultur. Ihr Leben war geprägt von Verlust, Überleben, Neubeginn und dem tiefen Wunsch, Zeugnis abzulegen – für diejenigen, die keine Stimme mehr haben. Sie tat das bis zuletzt.
Der Tod dieser Jahrhundertzeugin hinterlässt nicht nur eine Lücke in der Zeitzeugenschaft. Er ist ein Anlass, innezuhalten – und zu verstehen, was es bedeutet, sich der Vergangenheit zu stellen, um der Zukunft willen.
Eine Kindheit im Berlin der 1920er und 30er Jahre
Margot Friedländer wurde am 5. November 1921 in Berlin geboren, als Anni Margot Bendheim. Ihre Familie war jüdisch, bürgerlich, verwurzelt in der Hauptstadt. Sie wuchs gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Ralph in Berlin-Kreuzberg auf. In den Jahren der Weimarer Republik lebte sie ein Leben wie viele andere Jugendliche: Schule, Freunde, Alltag.
Doch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten veränderte sich alles. Die jüdische Bevölkerung wurde systematisch ausgegrenzt, entrechtet und verfolgt. Auch die Familie Friedländer wurde zur Zielscheibe antisemitischer Politik. Die Einschläge kamen näher – politisch, gesellschaftlich, schließlich existenziell.
Der Anfang vom Ende: Verhaftung, Flucht, Untertauchen
1942 wurde Margots Vater verschleppt und in einem Lager ermordet. Ihre Mutter und ihr Bruder versuchten zunächst, in Berlin zu überleben, bis sie schließlich 1943 deportiert wurden. Margots Mutter hinterließ ihrer Tochter eine kleine Tasche mit einem Adressbuch, einem Stück Bernsteinkette – und einem Satz, der das Leben der jungen Frau prägen sollte: „Versuche, dein Leben zu machen.“
Margot, damals 21 Jahre alt, entschloss sich unterzutauchen. Sie färbte sich die Haare rot, trug ein Kreuz, nahm einen gefälschten Namen an. 15 Monate lebte sie im Untergrund – in ständiger Angst, entdeckt zu werden. Diese Monate waren geprägt von Isolation, Hunger, Unsicherheit – und der Ungewissheit, ob sie den nächsten Tag erleben würde.
Verhaftung und Deportation nach Theresienstadt
Im April 1944 wurde sie verhaftet und ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Dort begegnete sie Leid, Tod – und gleichzeitig einer Form von Überlebenswillen, die sie nie vergessen sollte. Sie arbeitete im Lager in der Küche, überlebte Hunger, Krankheit, Zwang.
Im Mai 1945 wurde das Lager durch die Rote Armee befreit. Margot Friedländer war frei – doch fast ihre gesamte Familie war tot.
Diese Erfahrung ließ sie zeitlebens nicht los. Die Leere, die Schuld, das Überleben – all das wurde zu einem Teil ihrer Identität. Doch sie entschied sich nicht für das Schweigen, sondern für das Erinnern.
Ein neues Leben in Amerika
Nach dem Krieg lernte sie ihren späteren Mann Adolf Friedländer kennen, ebenfalls ein Überlebender des Holocaust. Gemeinsam wanderten sie 1946 in die USA aus, wo sie mehr als 60 Jahre lang lebte – zunächst in New York, später in Queens.
Margot arbeitete als Reisebüroangestellte, später nähte sie Kleidung, lebte ein zurückgezogenes Leben – und sprach viele Jahrzehnte nicht über das, was sie erlebt hatte. Erst nach dem Tod ihres Mannes 1997 begann sie, ihre Erinnerungen aufzuschreiben.
2003 kehrte sie erstmals für eine Gedenkveranstaltung nach Berlin zurück – und spürte, wie sehr sie mit dieser Stadt noch immer verbunden war. 2010, im Alter von 88 Jahren, beschloss sie endgültig zurückzukehren. Es war eine mutige Entscheidung – und eine politische.
„Versuche, dein Leben zu machen“ – eine Botschafterin der Erinnerung
Zurück in Berlin wurde Margot Friedländer zur unermüdlichen Zeitzeugin. Sie besuchte Schulen, sprach mit Jugendlichen, gab Interviews, hielt Reden. Sie erzählte – nicht um anzuklagen, sondern um zu erinnern. Sie wollte Bewusstsein schaffen.
Ihr Anliegen war nicht die Abrechnung, sondern die Mahnung: „Seid Menschen.“ Das war der Satz, mit dem sie jede Rede beendete. Es war keine Floskel. Es war eine Haltung.
Ihre Autobiografie, ebenfalls mit dem Titel „Versuche, dein Leben zu machen“, wurde ein viel beachtetes Zeitdokument. Ihre Stimme wurde zu einer der wichtigsten Mahnerinnen gegen Antisemitismus, Rassismus und das Vergessen.
Ob bei Fernsehauftritten, öffentlichen Lesungen oder Gesprächen mit Jugendlichen: Sie sprach mit Klarheit, Wärme, Menschlichkeit. Ihre Worte trafen – weil sie echt waren.
Sie verstand es, auch junge Menschen zu erreichen. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit dem Mut zur Verletzlichkeit. Mit der Bereitschaft, Schmerz zu teilen – und damit Brücken zu bauen.
Ehrungen, Auszeichnungen und gesellschaftliche Anerkennung
Für ihr Engagement wurde Margot Friedländer vielfach geehrt. Sie erhielt unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande, die Ehrenbürgerwürde der Stadt Berlin und zahlreiche Bildungspreise.
Sie war Trägerin des Leo-Baeck-Preises und des Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums Berlin. Viele Schulen, Bibliotheken und Initiativen bezogen sich in ihrer Arbeit auf ihre Botschaft.
Am Tag ihres Todes sollte sie das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland erhalten – eine Auszeichnung, die sie nicht mehr persönlich entgegennehmen konnte. Ihr Tod wenige Stunden vor der Verleihung macht diese Geste zu einem symbolischen Akt: der letzte Tribut einer Gesellschaft, die ihr viel zu verdanken hat.
Reaktionen auf ihren Tod: Ein Land trauert
Die Nachricht vom Tod Margot Friedländers löste bundesweit große Anteilnahme aus. Politikerinnen und Politiker aller demokratischen Parteien äußerten ihre Trauer und ihren Respekt.
Der Bundespräsident würdigte sie als „eine der eindrucksvollsten und mutigsten Stimmen unserer Zeit“. Die Berliner Landesregierung betonte, dass Friedländers Engagement Berlin menschlicher gemacht habe.
Auch viele jüdische Organisationen, Schülergruppen und Erinnerungsinitiativen äußerten ihre Trauer – und ihre Dankbarkeit. In sozialen Netzwerken fanden sich unzählige Nachrichten junger Menschen, die ihr begegnet waren. Ihre Worte, ihr Lächeln, ihre Handschrift – all das hat Spuren hinterlassen.
Ein Vermächtnis, das bleibt
Margot Friedländer war mehr als eine Zeitzeugin. Sie war eine Botschafterin der Menschlichkeit. Ihre Stärke lag nicht nur in der Erinnerung an das Leid – sondern im Glauben an das Leben danach.
Sie hat gezeigt, dass es möglich ist, nach der tiefsten Dunkelheit wieder Licht zu sehen. Dass es Mut braucht, sich zu erinnern – und noch mehr Mut, anderen davon zu erzählen.
Ihre Botschaft war immer auch eine Einladung: Schaut nicht weg. Fragt nach. Hört zu. Und handelt.
Ihr Vermächtnis lebt weiter – in den Schulen, in den Büchern, in den Herzen derer, die sie berührt hat. Und in der Verantwortung, die sie an uns alle weitergegeben hat.
Fazit: Eine Jahrhundertfrau geht – die Erinnerung bleibt
Der Tod von Margot Friedländer ist ein tiefer Verlust – für Berlin, für Deutschland, für die Erinnerungskultur.
Mit ihr endet nicht nur ein Lebensweg, sondern auch ein lebendiges Stück Geschichte. Doch das, was sie hinterlässt, ist nicht weniger wertvoll: Vertrauen in die Kraft des Erinnerns, in das Gute im Menschen – und in die Hoffnung, dass sich Geschichte nicht wiederholen muss, wenn wir sie kennen.
Margot Friedländer ist nicht mehr unter uns – aber ihre Worte, ihre Haltung und ihr Mut werden bleiben. Als Aufgabe. Und als Licht.